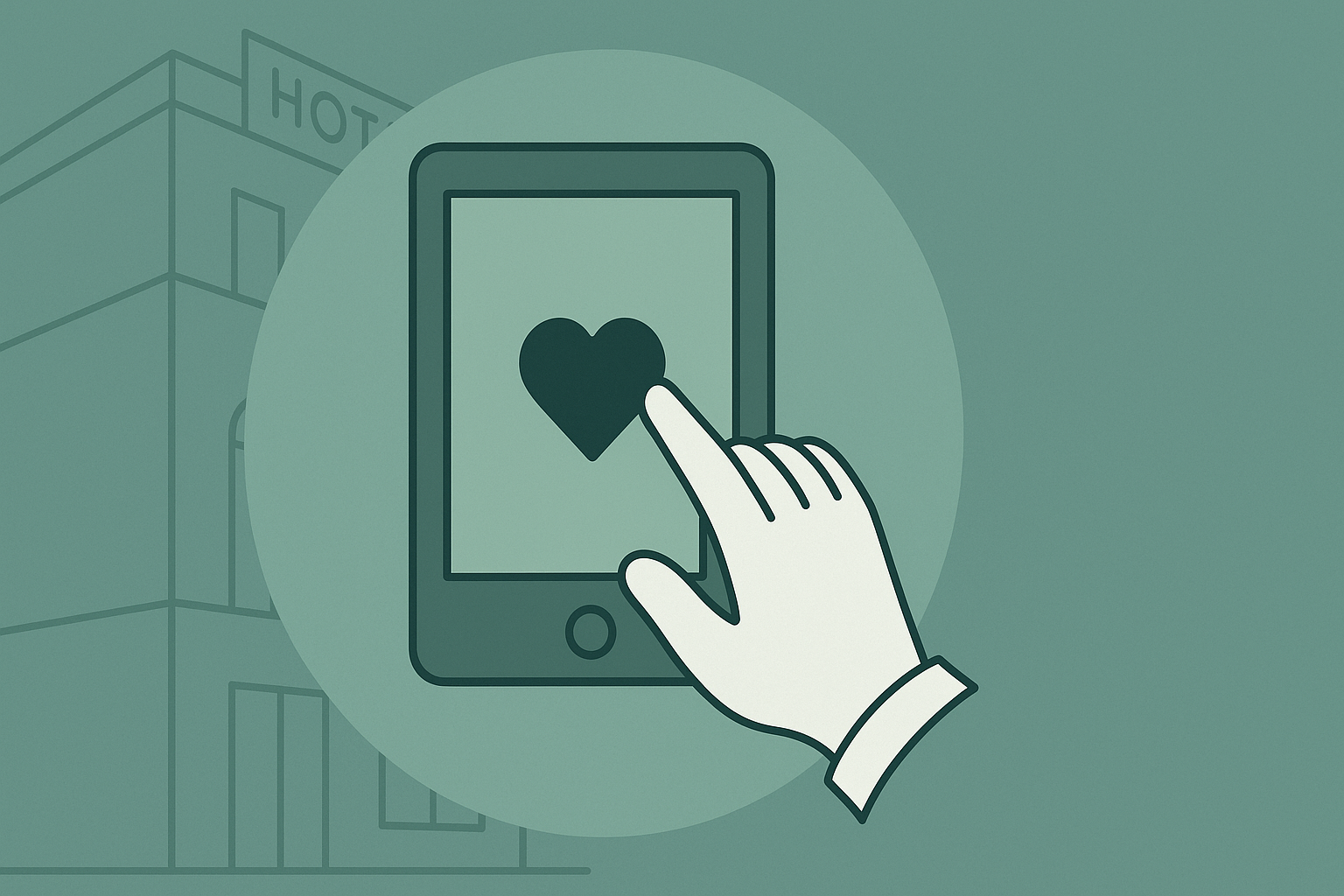Früher war ich operativ tätig, als Betriebsleiter in der Hotellerie und Gastronomie, als Verantwortlicher für die Erstellung und Implementierung von Konzepten in der gemeinschaftlichen Verpflegung. Verantwortlich für Abläufe, für Teams, für Kundenbetreuung, die benötigte Technik, schlicht, für alles, was im Tagesgeschäft zählt.
Heute begleite ich dieselbe Branche aus einer anderen Perspektive. Ich entwickle, strukturiere, beobachte, stelle die Fragen, die im Alltag oft untergehen. Nicht mehr als Teil der Linie, sondern mit dem Blick von außen – als KI-Manager. Manchmal schafft genau dieser Abstand den Raum, den es braucht, um wirksam zu sein.
Warum ich KI-Manager geworden bin
Ich habe mich bewusst entschieden, die Rolle zu wechseln. Nicht, weil ich die Branche satt hatte, sondern weil ich merkte: Wir stehen an einem Wendepunkt. Digitalisierung und Automatisierung sind keine Spielereien mehr. In Zeiten des Personalmangels sind sie entscheidend, um handlungsfähig zu bleiben. In meinem früheren Beruf in dem ich Konzepte für Ausschreibungen in der Gemeinschaftsverpflegung entwickelte, hatte ich schon die ersten Berührungspunkte mit machine learning.
Bei einem Beratungsgespräch für meine Weiterbildungen sprach mich KI dann voll an: Die Möglichkeiten, die Geschwindigkeit, die Perspektiven – das war mein Aha-Moment.
Ich war fasziniert, wie viel heute schon möglich ist – und wie dynamisch sich das Feld täglich entwickelt. Die Weiterbildung war für mich also nicht das Ziel, sondern ein Türöffner.
Was ein KI-Manager wirklich macht
Ein KI-Manager ist ein Brückenbauer, Übersetzer und Impulsgeber. Ich bin kein Entwickler, sondern jemand, der fragt:
- Was bringt euch wirklich was?
- Wie integriert sich KI in den Alltag, ohne bestehenden Routinen zu schaden?
- Wo hilft sie dem Team, ohne es zu ersetzen?
Ich begleite diesen Wandel mit Respekt – für gewachsene Abläufe, für Verantwortlichkeiten und vor allem für die Menschen, die sie tragen.
Früher bestand ein Großteil meiner Arbeit darin, Informationen zusammenzutragen: Ausschreibungen durchforsten, Webseiten absuchen, Angebote einholen, Daten sortieren. Das war oft mühsam – und hat Entscheidungen verzögert. Heute übernehmen Recherche-Agenten die ersten Schritte. Innerhalb weniger Stunden liegen erste Auswertungen vor. Nicht perfekt, aber schnell genug, um Ideen zu validieren – oder auch rechtzeitig zu verwerfen.
Statt in langen Präsentationen zu erklären, wie etwas funktioniert, lasse ich es heute lieber direkt erleben: ein Button, der reagiert, eine Mail, die sich selbst schreibt. Tools wie Make, n8n, Claude oder GPT machen es möglich, KI greifbar zu machen – nicht nur erklärbar. Es geht nicht mehr darum, ob KI „irgendwann“ nützlich sein könnte, sondern wie wir heute mit einfachen Mitteln starten können.
Dabei entwickeln sich Prozesse zunehmend selbstständig weiter. Eine KI liest Wettbewerberberichte, erkennt wiederkehrende Themen, extrahiert Bedürfnisse – und verschafft so Überblick, wo sonst Bauchgefühl regiert. Das Team bleibt fokussiert: auf Gäste, Produkt und Vision. Aber KI ersetzt keine Verantwortung. Sie bereitet vor, wir entscheiden.
Und genau hier liegt der entscheidende Punkt: Es geht nicht um Tools, sondern um Wirkung. Nicht um technologische Machbarkeit, sondern um Sinn. KI bringt nur dann etwas, wenn sie in reale Abläufe eingebettet wird – angepasst an Menschen, Aufgaben, Rahmenbedingungen. Viele Betriebe könnten längst profitieren – bei der Speiseplanung, im Bestellwesen, bei der E-Mail-Kommunikation. Aber oft fehlt die Zeit, sich mit komplexen Systemen auseinanderzusetzen.
Deshalb müssen die Lösungen einfach sein. Sofort verständlich. Niedrigschwellig im Zugang. Und vor allem: praxisnah. Learning by Doing ist für mich der nachhaltigste Weg. Wenn wir gemeinsam echte Use Cases durchspielen, kleine Pilotlösungen testen oder Fallstudien vorbereiten, verliert KI schnell ihre technische Schwere. Was vorher theoretisch oder zu abstrakt wirkte, wird plötzlich machbar.
Inzwischen ist GPT für mich mehr als nur ein Tool – es ist ein Kollege. Mehr noch, ein Sparringspartner, Assistent, Ordnungshelfer. An manchen Tagen schneller als ich. An anderen: überraschend inspirierend. Immer aber im Einsatz, immer mit dabei. Auch wenn es bei vereinzelten Prompts frustrierend werden kann.
Damit Teams mitziehen, braucht es Vertrauen – und Transparenz. Ich arbeite mit Miro, Trello oder klaren Visualisierungen, um sichtbar zu machen, woran wir gerade arbeiten. Was noch offen ist und was bisher erreicht wurde. Wenn Menschen sehen, dass sie mitdenken dürfen und mitgestalten können, verändert das die Dynamik.
Natürlich gehört auch Verantwortung zum Thema KI dazu. Sie muss nicht nur funktionieren – sie muss vertretbar sein. Ich achte auf saubere Datenflüsse, DSGVO-Konformität, auf erklärbare Logiken. Technik ist das eine. Manche Fragen lassen sich nicht einfach mit Code beantworten. Eine der poetischsten war:
„Kann man eine kaputte KI reparieren?“
Eine Frage die auch mit Verantwortung zu tun hat. Ich glaube, ja. KI ist eine Maschine, ein Werkzeug. Und Maschinen oder Werkzeuge kann man reparieren. Vielleicht wurde diese Frage auch schon bei einem oder mehreren Gläsern Wein diskutiert – irgendwo zwischen Ethik, Erwartung und Alltag. Aber ich mag sie, weil sie uns daran erinnert, dass Verantwortung auch Spielraum braucht.
Gute Metriken gehen für mich über Zahlen hinaus. Ich messe nicht nur Zeit oder Ersparnis, sondern achte auch auf subtile Signale: Wie geht das Team mit dem neuen Tool um? Entsteht Entlastung – oder Widerstand? Wenn jemand sagt: „Das hat mir wirklich geholfen“ oder ich sehe, dass eine Aufgabe nicht mehr auf die To-do-Liste wandert, ist das für mich oft aussagekräftiger als ein Prozentwert. Genau hier spielt Feedback eine zentrale Rolle. Ich arbeite am liebsten mit Menschen, die offen sagen, was sie brauchen – und die genauso gut zuhören können. Mein Leitsatz dabei: „Mir ist es wichtig, weil es dir wichtig ist.“ Diese Haltung schafft Vertrauen, gerade in einem Umfeld, das sich ständig verändert.
Sichtbarkeit ist dabei ein eigener Lernprozess. Viele gute Ideen bleiben unsichtbar, weil niemand sie nach außen trägt. Ich lerne selbst gerade, wie wichtig es ist, dran zu bleiben, strukturiert zu kommunizieren und sich nicht entmutigen zu lassen. Damit Ideen nicht versanden, braucht es Fokus. Ich plane realistisch, setze erreichbare Meilensteine und bleibe flexibel, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt. Struktur heißt für mich: weniger Hektik, weniger Korrekturen, mehr Klarheit.
Und manchmal hilft es, einfach eine Runde zu gehen. Meine besten Gedanken kommen beim Laufen – morgens oder abends, wenn ich mir bewusst Zeit nehme. Dann frage ich mich: Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Oder verliere ich mich gerade in einer Richtung, die gut gemeint, aber nicht zielführend ist? Solche Momente helfen mir, den Kompass auszurichten. Sie erinnern mich daran, warum ich das hier mache. Ich sehe mich nicht als klassischen Projektleiter. Ich sehe mich als jemand, der Technologie mit Menschlichkeit verbindet, Räume schafft für Lernen, Transparenz und Vertrauen. Jemand, der Wirkung nicht nur in Zahlen misst, sondern in Entlastung, Akzeptanz und Alltagstauglichkeit. Mit dem Hospitality-KI-Assistenten, den wir entwicklen, haben wir einen Anfang gemacht. Ich weiß: Es ist nicht das Ziel – aber es zeigt, was möglich ist. Und es macht mir Lust auf mehr. Wenn mich jemand fragt, was einen guten KI-Manager ausmacht, sage ich: Es sind die, die gut zuhören, übersetzen und ermöglichen – mit Ethik, Neugier und einem Hauch Philosophie.